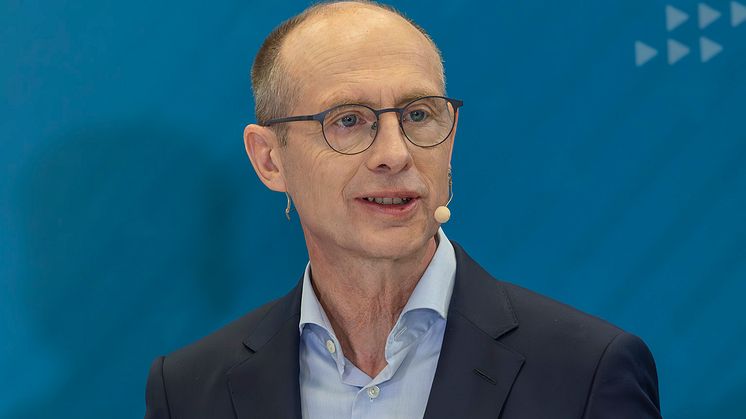Pressemitteilung -
Jahrespressekonferenz 2025 der Bayernwerk AG | Bayernwerk treibt mit Wachstumskurs die Entfesselung des Energiesystems voran
Vorstellung der Entwicklungen in fünf relevanten Bausteinen des Energiesystems:
- weiterhin Milliarden-Budgets für bayerische Energiewende
- Versorgungssicherheit vor neuen Herausforderungen
- Potenzialanalyse für 1.000 neue bayerische Windräder
- Entwicklung Bayerns zum Speicherland
- politische Kurskorrekturen nötig
Mit Milliardenbeträgen treibt das Energieunternehmen Bayernwerk die Transformation in eine neue Energiewelt voran und setzt so die im letzten Jahr gestartete „Wachstumsoffensive Energiezukunft Bayern“ fort. Dazu nimmt das Bayernwerk die gesamte Breite des Energiesystems in die Hand. So schafft das Unternehmen die Grundlagen für die Entwicklung Bayerns zum Speicherland oder zeigt einen Weg auf, der die Netzintegration von 1.000 zusätzlichen bayerischen Windrädern ohne nennenswerten Netzausbau ermöglicht. Zum Gelingen der Energiewende braucht es laut dem Bayernwerk auch politische Korrekturen. Dazu zählen mehr freier Markt und netzorientierte Anreize. Es gehe um die Finanzierbarkeit, Bezahlbarkeit, Gerechtigkeit und damit um die Akzeptanz der Energiewende.
Regensburg. „Nach der Entfesselung der Erneuerbaren Energien und der Entfesselung der Netze geht es jetzt um die Entfesselung des Energiesystems“, erklärt Bayernwerk-Vorstandsvorsitzender Dr. Egon Leo Westphal bei der Jahrespressekonferenz des Bayernwerks in der Regensburger Unternehmensleitung. Gemeinsam stellten Dr. Egon Leo Westphal, Finanzvorständin Dr. Daniela Groher sowie Markt- und Personalvorstand Albert Zettl die Entwicklungen in fünf relevanten Bausteinen des Energiesystems vor.
1. Erneuerbare Energien, Energienetze und Netzkapazitäten
„Die Energiewende ist für uns Vision und Mission in einem. Die alte Energiewelt gibt es nicht mehr. Eine Neue muss gebaut werden. Es gibt kein Zurück. Wir gehen daher mit historischen Milliardenbudgets weiter aufs Ganze und führen unsere Wachstumsoffensive Energiezukunft Bayern fort. Das Bayernwerk ist der Maschinenraum der Energiewende“, betont der Vorstandsvorsitzende. Dabei werde die Energiewende für die Menschen sichtbar und spürbar. Rund 800.000 dezentrale Einspeiseanlagen wirken mittlerweile auf das Energienetz der Bayernwerk Netz GmbH. „Das Zusammenspiel zwischen den Erneuerbaren Energien und den Netzen ist ein Spiel mit den Kapazitäten. Die sind begrenzt, müssen intelligent genutzt und mit Tempo erweitert werden“, betont Egon Leo Westphal. Allen voran stehe ein uneingeschränkt ambitionierter Netzausbau.
Weiter auf Wachstumskurs: 1,8 Milliarden Euro in 2025 – 4.500 Mitarbeitende
Bayernwerk-Finanzvorständin Daniela Groher verwies darauf, dass die Energiewende unternehmerische Kraft und Stabilität erfordere. „Die Energiezukunft ist auch die Bayernwerk-Zukunft“, so Daniela Groher. Offenkundiges Merkmal für die Ambition sind die finanziellen unternehmerischen Ressourcen, die laut Groher maßgeblich in den Ausbau der Energienetze fließen. Daniela Groher: „In 2023 haben wir erstmals die Milliardengrenze überschritten. In 2024 haben wir unsere Mittel auf 1,3 Milliarden Euro erhöht. In 2025 springen wir mit über 1,8 Milliarden Euro in eine neue Dimension. In 2026 werden wir über 2,1 Milliarden Euro aufwenden. Damit stecken wir im Drei-Jahres-Zeitraum 2024 bis 2026 in Summe über 5,4 Milliarden Euro in die bayerische Energiewende.“ Personalvorstand Albert Zettl erklärte: „Für das Wachstum im regulierten Geschäft und im Wettbewerbsmarkt wachsen wir auch als Organisation weiter. Mittlerweile beschäftigt die Bayernwerk-Gruppe rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 1.500 mehr als vor zwei Jahren.“
Mit 1.000 Windrädern wie „Offshore-Park“ an Land
Was den Zubau Erneuerbarer Energie betrifft, sieht Egon Leo Westphal einen Game-changer für das Energiesystem in der Bündelung mehrerer Erzeugungsanlagen an einem Netzverknüpfungspunkt. Mit einer Potentialanalyse habe man einen wahren Kapazitätsschatz ausfindig gemacht, den es nun zu bergen gelte. Egon Leo Westphal: „1.000 Windräder könnten wir zusätzlich an unser Netz bringen, und das ohne nennenswerten zusätzlichen Netzausbau.“ Heute hat jede PV-Freiflächenanlage ihren eigenen Netzverknüpfungspunkt, den sie allein nutzt. Dieser ist leistungsseitig so konzipiert, dass die PV-Anlage theoretisch mit ihrer maximalen Leistung einspeisen kann. Das tut sie aber selten und speist ohnehin nur in einem begrenzten Zeitraum ein. Es bleibt also an diesem Netzverknüpfungspunkt genügend Potenzial, um eine oder weitere Anlagen dort anzuschließen, zum Beispiel Wind. Im Fachjargon heißt das Überbauung. Weitere Vorteile: Durch die Nutzung eines bestehenden oder gemeinsamen Netzverknüpfungspunktes wird bei Überbauung nahezu kein zusätzlicher Netzausbau erforderlich. Zudem zeigt ein Pilotprojekt, dass bei der Überbauung von PV-Anlagen mit Windkraft die Erzeugungsmenge der einzelnen Anlagen nahezu stabil bleibt. „Wenn man dieses Potential noch in Verbindung mit Großbatteriespeicher bringt, wirkt das in dieser Kombination wie ein Off-Shore-Windpark an Land“, so der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende.
2. Speicher als neuer Player – Speicherland Bayern umsetzen
„Bayern ist das PV- und Sonnenland. Jetzt wollen wir auch das Speicherland Bayern umsetzen“, so Egon Leo Westphal. Das Bayernwerk ist das erste Unternehmen, das mit Netzwirksamkeit, Netzneutralität und Netzdienlichkeit Betriebsmodelle für die Speicherintegration entwickelt hat und zum Einsatz bringt. In der jetzigen Transformationsphase des Systems liegt ein Fokus vor allem auf netzneutralen und netzdienlichen Speichern. „Wichtig ist, dass wir die netzdienliche Speicherfahrweise mit der Bundesnetzagentur erfolgreich als regulatorisch anerkannte Alternative zum lokalen Netzausbau auf den Weg gebracht haben. Wir sind auch der erste Verteilnetzbetreiber, der einen netzdienlichen Speicher (Landkreis Cham) ausgeschrieben hat. Den Baukostenzuschuss (BKZ) für netzneutrale und netzdienliche Speicher haben wir um 70 Prozent gesenkt“, so Egon Leo Westphal.
Strategische Positionierung am Speichermarkt
Markt- und Personalvorstand Albert Zettl verwies auf die wettbewerblichen Potentiale des Unternehmens: „Wir wollen mit der Bayernwerk Natur eine strategische Positionierung am Speichermarkt aufbauen, um in allen Facetten am Ball zu sein und Lösungen zu bieten. Aktuell haben wir 35 Megawattstunden an eigenen Speicherkapazitäten in Betrieb, 245 Megawattstunden in der Umsetzung und 660 Megawattstunden in der Pipeline. In Summe arbeiten wir an rund 50 Projekten.
3. Versorgungssicherheit durch Digitalisierung und Steuerung
„Versorgungssicherheit und Steuerbarkeit im Netzbetrieb gehören zusammen. Das Energiesystem der Zukunft ist ein steuerndes und ein gesteuertes System “, betonte Daniela Groher. Deswegen lasse man eine Digitalisierungswelle durch die Energienetze und das ganze Unternehmen laufen. Ein starker Fokus gilt allen Steuerkomponenten. „Wir bringen in diesem Jahr rund 3.000 digitalisierte und teildigitalisierte Ortsnetzstationen in das Energienetz. Beim Einbau Intelligenter Messsysteme, sogenannter Smart Meter, zählen wir zu den Treibern. Aktuell haben wir 145.000 Smart Meter verbaut. Für 2025 peilen wir den Einbau von 100.000 Smart Metern an“, erklärte Daniela Groher.
Management von Netzengpässen ist Alltag im Netzbetrieb
Für den Bayernwerk-Vorstandsvorsitzenden war immer absehbar, dass das Management von Engpässen Alltagsgeschäft im Netzbetrieb wird. Das neue Energiesystem sei da und das zeigt sich laut Egon Leo Westphal an zwei Beispielen: „Im letzten Jahr haben wir bilanziell erstmals mehr Strom aus dem Bayernwerk-Netz exportiert als importiert. Und bilanziell deckt sich der Strombedarf im Bayernwerk-Netz zu 96 Prozent aus Erneuerbarer Energie. Das Bayernwerk-Netz ist aus europäischer Sicht schon längst ein wetterabhängiges Großkraftwerk.“
Das Engpass-Management schilderte Egon Leo Westphal in drei Stufen. Die erste Stufe sind Rückspeisungen zum Übertragungsnetzbetreiber Tennet. „Reichen der regionale Verbrauch und Speicherkapazitäten nicht aus, um die bei Sonne mittlerweile gewaltigen Einspeisemengen zu nutzen, speisen wir den überschüssigen Strom ins Übertragungsnetz der Tennet zurück – und damit in das europäische Verbundnetz. Das ist der Kernmechanismus des Energiesystems, das Grundkonzept des Zusammenwirkens der deutschen Netzebenen. Das passiert schon lange regelmäßig und mittlerweile mit bis zu 6.000 Megawatt, wie am 18. März, als wir eine Rekordeinspeisung in unser Netz von 12.000 Megawatt hatten. Fast ein Viertel der deutschen Solarspitze kommt von uns“, so Westphal.
Wenn die Kapazitäten des Übertragungsnetzes oder auch im Verteilnetz ausgereizt sind, greift mit dem sogenannten Redispatch die nächste Stufe. „Das ist die zwischenzeitliche Regelung von Erzeugungsanlagen zur Reduzierung der Einspeisung“, erklärte Westphal. Im Bayernwerk-Netz wirkt sich die Masse hunderttausender angeschlossener PV-Anlagen wie nirgendwo anders auf die Menge der Regelungen aus. Westphal: „Für 2025 rechnen wir mit knapp zwei Millionen Redispatch-Maßnahmen.“
Was laut Egon Leo Westphal aktuell auch diskutiert wird, sind kontrollierte und zeitlich wie regional begrenzte Abschaltungen
im Stromnetz nach Paragraf 13.2, Energiewirtschaftsgesetz, die der Übertragungsnetzbetreiber ausrufen würde. Die Ursache für derartige Abschaltungen können temporäre Engpässe auf unterschiedlichen Netzebenen sein. Das wären beispielsweise hohe Transitströme im europäischen Übertragungsnetz gepaart mit enormen Rückspeisungen aus dem Verteilnetz. „Kontrollierte Abschaltungen wären als Schutzmaßnahme das letzte Mittel, wenn gängige Maßnahmen wie Schaltungen oder Redispatch vollumfänglich ausgeschöpft sind, um Engpässe im Netz auszugleichen“, betont der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende. Eine Aussage, ob eine derartige Maßnahme wirklich erforderlich werden könnte, könne man nicht treffen. Egon Leo Westphal: „Was wir wissen und worauf wir vertrauen: Im Verteilnetz konnten wir bislang alle Engpasssituationen sehr gut im normalen Netzbetrieb mit den gängigen Mechanismen meistern. Wir bleiben da auch mit dem Blick nach vorne zuversichtlich. Eine Garantie, dass eine derartige Maßnahme gänzlich ausgeschlossen ist, kann allerdings niemand geben. Deshalb bereiten wir uns im Verbund aller Netzbetreiber gewissenhaft auf derartige Szenarien vor.“
4. Die Energiewende als dezentrale Strom- und Wärmewende
Markt- und Personalvorstand Albert Zettl richtete den Blick auf das Schlagwort der Sektorenkopplung. „Es geht um die Verbindung von Strom, Wärme und Mobilität“, erklärte Albert Zettl. Ein hohes Klimapotential liege in der Wärmeversorgung. Zettl: „Die Hälfte des CO2-Fußabdrucks entsteht aus der Wärmeversorgung.“ Deshalb widme sich das Unternehmen mit Nachdruck der verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung. „Neben Pilotprojekten haben wir mit der Rosenheimer INEV ein Planungsbüro für die kommunale Energiewende unter das Dach der Bayernwerk-Gruppe gebracht“, so der Marktvorstand. Man begleite bereits über 30 Kommunen in der kommunalen Wärmeplanung.
Mit der Tochter Bayernwerk Natur sei man stark im Lösungsgeschäft unterwegs und biete die gesamte technologische Bandbreite. „Ein echtes Highlight der Wärmewende ist unsere Geothermie-Anlage zur Wärmeversorgung Poings. Wir bauen die Wärmeversorgung für das BMW-Werk in Dingolfing oder arbeiten mit der Regensburger Rewag an einer Machbarkeitsstudie für eine industrielle und CO2-neutrale Wärmeversorgung auf Basis von Wärme aus Flusswasser und Abwasser“, erläutert Albert Zettl. Mit Quartiers-, Wohn- und Betriebskonzepten schnüre man alle Elemente der dezentralen Energiewende um das Leben der Kunden herum. „In der der E-Mobilität sind wir dabei, das bidirektionale Laden von E-Fahrzeugen als nächsten Player ins System zu bringen“, so Zettl.
5. Das Gelingen der Energiewende erfordert Kurskorrekturen
Einen neuen und kritischen Blick auf die Energiewende fordert Egon Leo Westphal, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten. Vor allem stellte er die Fragen nach der Finanzierbarkeit, der Bezahlbarkeit und der Gerechtigkeit. Egon Leo Westphal: „Erstens: Die politische Planung der Energiewende läuft in viel zu langen, theoretischen Korridoren. Das muss so nahe wie möglich an der Realität geplant werden, um jeden Euro effizient und wirkungsvoll einzusetzen. Zweitens: Die Erneuerbaren Energien brauchen schon lange keinen finanziellen Anschub mehr. Sie sind längst erwachsen geworden und systemrelevant. Warum fördern wir den Zubau Erneuerbarer noch? Wir müssen raus aus der Planwirtschaft und brauchen freie Fahrt für Markt und individuelle Verantwortung. Und Drittens: Warum soll die eigenoptimierte Energieversorgung derjenigen, die sich das aufgrund ihrer individuellen Situation leisten können, von denjenigen bezahlt werden, die das für sich selbst nicht tun können?“
Westphal betont, dass Technik und Physik die Entwicklung des Systems bestimmen. Erneuerbare Energien und alle Komponenten im Netz müssten dorthin, wo es für das System passend ist. „Deshalb fordern wir ein dynamisches Umsetzungskonzept für die bayerische Energiewende, das den Ausbau des Energiesystems steuert und regelmäßig entlang der Realität neu justiert“, so Egon Leo Westphal. Es sei jetzt die Zeit der Entscheidungen. Man müsse korrigieren, um das energiewirtschaftliche Dreieck abzusichern. Westphal: „Die Balance zwischen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist der Stabilitätsanker unserer Energieversorgung. Und die ist der Stabilitätsanker unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“
_________________________________________________
Hinweis für Journalistinnen und Journalisten
Dieser Pressemitteilung angehängt und auf der Webseite Jahrespressekonferenz 2025 | Bayernwerk finden Sie weiteres Pressematerial: Das Statement der Vorstände zum Download sowie Einzelinterviews mit den Vorständen des Bayernwerks zur freien Verwendung. In der Bayernwerk Mediathek Jahrespressekonferenz Bayernwerk 2025 – BAG Mediathek finden Sie die Aufzeichnung der Konferenz und die Einspieler zur Ansicht. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. Besten Dank!
Links
Themen
Kategorien
Regionen
Kurzprofil Bayernwerk AG
Seit 100 Jahren steht der Name Bayernwerk für Energie in Bayern. Die Bayernwerk AG steuert die Unternehmen der Bayernwerk-Gruppe. Gemeinsam mit den Menschen in Bayern gestaltet die Unternehmensgruppe die Energiezukunft im Freistaat aktiv mit und sorgt dafür, dass immer mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht. Die Bayernwerk-Gruppe setzt sich mit innovativen Lösungen für moderne und sichere Energienetze, Elektromobilität, dezentrale Energieerzeugung oder für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung ein. Ein starker Fokus liegt darauf, die Bürgerinnen und Bürger in Bayern bei ihrer persönlichen Energiewende zu unterstützen. Die Unternehmen der Bayernwerk Gruppe fördern die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den bayerischen Regionen.
Sitz der Bayernwerk AG ist Regensburg. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter des E.ON-Konzerns.