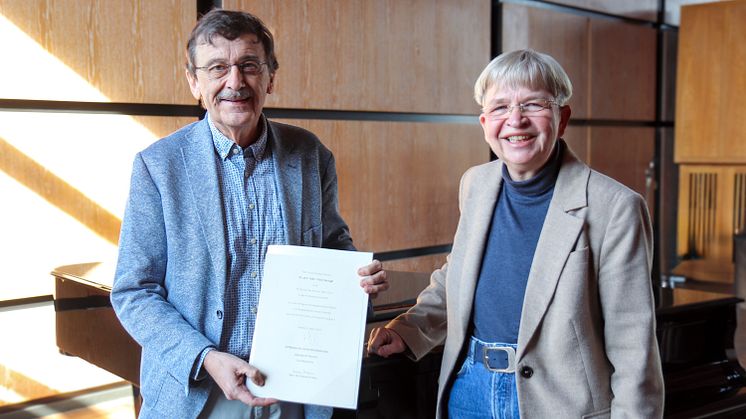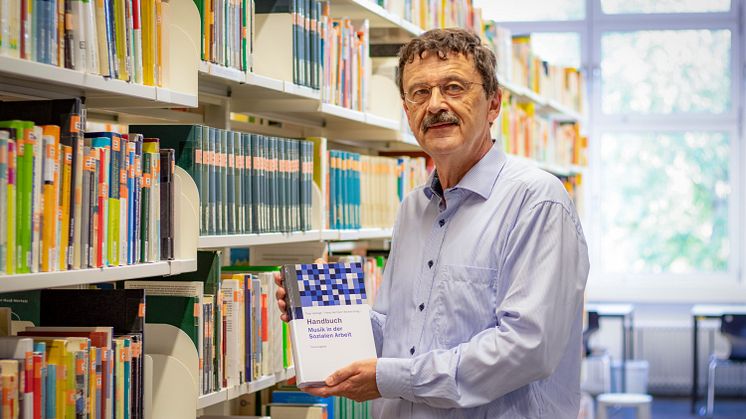
Pressemitteilung -
Mehr Lebensqualität durch Musik | Prof. Dr. Theo Hartogh entwickelte maßgeblich die Musikgeragorik mit und widmete seine Arbeit dieser Fachdisziplin – nun geht er in den Ruhestand
Mit seiner Habilitation hat er die erste umfassende wissenschaftliche Arbeit des sich damals neu etablierenden Fachgebiets vorgelegt. Entscheidend beteiligt an der (Weiter-)Entwicklung der Musik- und Kulturgeragogik, war er von 2009 bis 2024 zweiter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik e.V. Nun geht Prof. Dr. Theo Hartogh Ende März in den Ruhestand. Das Fach Musikpädagogik und die interdisziplinäre Zusammenarbeit – vor allem mit dem Fach Soziale Arbeit – prägte der 1957 gebürtige Cloppenburger an der Universität Vechta und seiner Vorgängerinstitutionen maßgeblich.
Die Musik war schon immer sein Begleiter. Schulmusik, Klavier, Musikwissenschaft und Biologie studierte Hartogh in Hannover und Hamburg. Nach dem Referendariat war er als Lehrer in Vechta tätig und leitete den Philharmonischen Chor Quakenbrück. 1998 promovierte Hartogh an der Technischen Universität Chemnitz mit einer Arbeit zur musikalischen Förderung geistig behinderter Menschen. Seine Habilitation an der Universität Leipzig legte den Grundstein für die Musikgeragogik, ein Fachgebiet, das sich mit der musikalischen Bildung im Alter beschäftigt.
Auf das lebenslange Lernen stieß Hartogh erstmals in seiner Studienzeit im Rahmen seines Ersatzdienstes beim Roten Kreuz. Unter anderem musizierte er mit Kommilitonen in Alteneinrichtungen und war erstaunt über die vielfältigen Möglichkeiten, mittels Stimme und einfachen Instrumenten mit Demenzerkrankten zu musizieren und in Kontakt zu treten. In seiner späteren wissenschaftlichen Arbeit ging es dem Professor weniger um Therapie, sondern vielmehr um ein Recht auf Freude und Teilhabe durch das Erleben von Musik. „Es ist eher ein Bildungsangebot, neue Lieder einzustudieren und neue Instrumente kennenzulernen“, so Hartogh. Die Chancen sind verblüffend: In einer von ihm betreuten Promotion konnte gezeigt werden, dass Menschen mit Demenz, die noch nie in ihrem Leben Klavierunterricht hatten, in der Lage waren, eine Melodie auf dem Instrument zu lernen, zu spielen und sie zu erinnern.
Das noch junge Fachgebiet der Musikgeragogik beschäftigt sich mit der musikalischen Bildung und Teilhabe im Alter sowie mit musikbezogenen Vermittlungs- und Aneignungsprozessen. Die Arbeit mit alten und hochaltrigen Menschen erfordert dabei ein anderes didaktisch-methodisches Vorgehen als in der Musikpädagogik mit jungen Menschen. Für Musik mit alten Menschen und das Musizieren im Alter sind die Berücksichtigung persönlicher Lebenserfahrungen, Lernen bei geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen sowie Validation von besonderer Bedeutung. Wichtige Erkenntnisse stammen aus Nachbardisziplinen wie Alterspsychologie, Pflegewissenschaft, Soziale Arbeit, Gerontologie, Musiktherapie und Heilpädagogik. Dies alles hat Auswirkungen auf Forschung, Ausbildung und Praxis. „Mich begeistern die enge Verzahnung, die interdisziplinäre Ausrichtung sowie die möglichen Kooperationen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik, dem Deutschen Musikrat, der Deutschen musiktherapeutischen Gesellschaft und dem Bundesverband Chor und Orchester“, führt Hartogh aus.
Wichtige Meilensteine der Fachdisziplin waren und sind für ihn noch immer „Forschungsprojekte, Fachtagungen und Publikationen, viele davon gemeinsam mit den Kollegen Hans Hermann Wickel und Kai Koch“. Darüber hinaus seien die erfolgreiche Etablierung von hochschulzertifizierten Weiterbildungen an Landesmusikakademien sowie an deutschen und Schweizer Hochschulen wichtige Wegpunkte gewesen. Weiterbildungen und Fachtagungen – unter anderem an der Katholischen Akademie Stapelfeld zum Thema Musik in Demenz, zusammen mit Dr.in Ulrike Kehrer durchgeführt – zeigen dabei eindrücklich die praxisnahe Forschung Hartoghs auf.
Strahlkraft über die Wissenschaftcommunity hinaus entwickelten solche Vorhaben wie das von ihm geleitete Verbund-Projekt „ReKuTe – Partizipative Wissenschaft für Region, Kultur und Technik“. Mit einer innovativen Methodik ermöglichte Musiklehrerin Anke Feierabend in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Theo Hartogh Demenzerkrankten, früher erlernte Musikkenntnisse wiederzubeleben. Die Musiklehrerin gab einer dementen, damals 79-jährigen Schülerin, die als Jugendliche Geige gespielt hatte, erneut Geigenunterricht. In Zusammenarbeit mit der Musikgeragogin Dr.in Kerstin Jaunich wurden Anleitungen erstellt und erläuternde Videoaufzeichnungen der speziell ausgerichteten Vermittlung als Lehrmaterial für Instrumentallehrkräfte, Angehörige und Betreuungskräfte online gestellt (www.musikunddemenz.de).
Und was waren prägnante Stationen – auch für die gesellschaftliche Sichtbarkeit der Fachdisziplin? „Die Gründungen der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik sowie der Bundesinitiative Musik und Demenz“, führt Hartogh aus. Letztgenannte hat beispielsweise das Ziel, in ganz Deutschland bedarfsgerechte musiktherapeutische, musikgeragogische und musikalisch-künstlerische Angebote für Menschen mit demenziellen Veränderungen nachhaltig sicherzustellen. „Die wachsende Zahl von demenzbetroffenen Menschen stellt eine der großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft dar“, ist sich Hartogh sicher. „Sowohl im Rahmen ihrer Behandlung, Pflege und Betreuung als auch mit dem Ziel, ihnen möglichst umfassende kulturelle und soziale Teilhabe sowie hohe Lebensqualität zu ermöglichen, sind die vielfältigen Potenziale von Musik entschlossener und deutlich stärker als bisher zu nutzen!“. Der Bedarf an dafür in Frage kommenden musikalischen und musikalisch-künstlerischen Angeboten, musikgeragogischen beziehungsweise -pädagogischen Aktivitäten sowie musiktherapeutischen Interventionen würden in Einrichtungen der Altenhilfe, in Musikschulen sowie im häuslichen Umfeld bisher nicht gedeckt werden.
Wegmarken für ihn persönlich seien „die musikgeragogischen, aber auch kulturgeragogischen Forschungs- und Publikationsprojekte zusammen mit der Sozialen Arbeit, der Gerontologie und externen Partnern, im Speziellen zum Instrumentalunterricht mit Demenzbetroffenen und zur kultur- und musikgeragogischen Praxis.“ Und was kommt nun? „Es stehen erst einmal viele Besuche bei Freunden und Verwandten und einige Reisen an; auch Besuche bei früheren Erasmuspartnern, hier haben sich über die Zeit Freundschaften entwickelt“, führt Hartogh aus. Und die Wurzel all des Guten? „Musik hat mich nicht nur beruflich, sondern seit frühester Kindheit auch privat begleitet. Ich bin immer wieder gerne als Chorleiter, Dirigent oder Pianist aufgetreten; heute ist das Klavier nicht mehr aus meinem Alltag wegzudenken und ich werde nun wieder mehr spielen, solistisch sowie als Begleiter. Und natürlich höre ich viel Musik; da bin ich nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt.“ Studierende an der Universität Vechta könnten ebenso von Musik profitieren: „Die lobenden Gutachterrückmeldungen und die positiven Bewertungen der Lehrveranstaltungen in Musikpädagogik, Musikwissenschaft und künstlerischer Praxis sprechen eine klare Sprache: Studierende erwartet im Fach Musik eine familiäre und motivierende Arbeitsatmosphäre mit engem Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden; hiervon kann sich jeder in den öffentlichen Veranstaltungen des Fachs Musik überzeugen!“, so Hartogh. Aber auch die Wissenschaft lässt ihn nicht ziehen: „Im Sommersemester 2025 sind noch Publikationsprojekte abzuschließen sowie Bachelor- und Masterarbeiten zu betreuen – es wird also ein ,gleitender‘ Abschied.“

Bei der Übergabe der Entlassungsurkunde: Prof. Dr. Theo Hartogh und Vizepräsidentin Prof.in Dr.in Marion Rieken.
Werdegang Prof. Dr. Theo Hartogh
- 1977–1984 Studium: Schulmusik, Klavier, Musikwissenschaft und Biologie für das höhere Lehramt in Hannover und Hamburg
- 1985–1986 Referendariat, Studienseminar Wilhelmshaven
- 1986–1993 Schuldienst in Vechta (Liebfrauenschule, Kolleg St. Thomas)
- 1987–1998 Leiter des „Philharmonischen Chores Quakenbrück“
- 1993–2005 Professor für Musik/Musikpädagogik an der Katholischen Fachhochschule Norddeutschland, 2002–2005 Prorektor
- 1998 Promotion: Dr. phil. an der Technischen Universität Chemnitz; Dissertationsthema „Musikalische Förderung geistig behinderter Menschen“
- 2005 Habilitation: Dr. phil. habil. (Musikpädagogik) an der Universität Leipzig; Habilitationsthema „Musikgeragogik“
- Seit 2005 Professor für Musikpädagogik an der Universität Vechta mit diversen hochschulpolitischen Ämtern